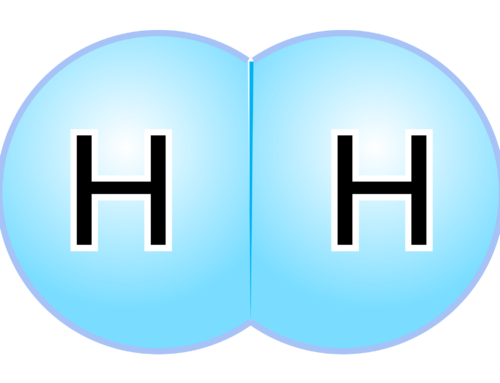Ernstfall Euro: Nach dem Desaster im eigenen Land gefährdet die Bundesregierung nun auch noch das europäische Projekt
Der Euro wird kommen, aber nicht bleiben, meinte Mitte der neunziger Jahre US-Notenbankchef Alan Greenspan. Zu unterschiedlich seien die Länder der Europäischen Union, zu vielfältig ihre jeweiligen wirtschaftspolitischen Bedürfnisse, um eine gemeinsame Währung mit einem einheitlichen Zins auf Dauer auszuhalten. Irgendwann, so Greenspans Umkehrung eines berühmten Diktums von Willy Brandt, werde wieder auseinander wachsen, was nicht zusammen gehört. Ob frommer Wunsch eines parteiischen Imperialisten oder begründete Überlegung eines gewieften Zentralbankpraktikers – das Experiment Euro ist noch zu frisch, um abschließend zu urteilen.
Bislang jedenfalls hat Greenspan nicht Recht behalten. Und das ist gut so. Denn der Euro ist eine Errungenschaft, die sich zu verteidigen lohnt. Er ist ein Beispiel, vielleicht sogar ein Vorbild für regionale Kooperationen in anderen Teilen der Welt. Er ist eine Alternative zum Dollar, ein noch bescheidener, aber künftig vielleicht stärkerer Garant für eine multipolare Welt. Dass der Euro zwischenzeitlich immer wieder in den Verdacht geriet, ein Weichei zu sein, gehört zu jenem Kapitel Schwachsinn, das offenbar jeden Fortschritt der Vernunft begleitet. Denn von einem Stabilitätsproblem kann nirgends die Rede sein. Von Anbeginn war der Euro nach innen eine harte Währung, und längst ist er es auch nach außen geworden. Wenn überhaupt Gefahren für den Geldwert lauern, dann ist wohl eher Deflation das passende Stichwort.
Nicht die Währung selbst, sondern das Korsett, in das sie gezwängt wurde, ist das eigentliche Problem. Der Euro ist ein begabtes Kind mit grandiosen Entwicklungschancen, aber gleichzeitig so geschnürt, dass es sich nicht bewegen kann. Gut für einen Schönheitswettbewerb der Währungen, aber zu unflexibel, um die wirtschaftliche Entwicklung Europas hinreichend zu befördern. Hüter der Kleiderordnung ist vor allem die Europäische Zentralbank. Mit einer Verfassung, die ihr noch mehr Unabhängigkeit gewährt als die Bundesbank je hatte, ist sie zu einem Hort von Ideologen geworden, die im Stabilitätswahn ein Zinsniveau vorgeben, das den Besitzern von Geldvermögen, aber nicht den kreditabhängigen Unternehmen dient. Es wäre an der Zeit, die Ziele der Europäischen Zentralbank neu zu justieren, sie in die wirtschafts- und sozialpolitische Pflicht zu nehmen, nicht zuletzt um die Zinslast der Staaten zu verringern. An dieses Thema wagt sich allerdings niemand heran, selbst die großen Elefanten nicht. Und so halten sich die Sündernationen Deutschland und Frankreich an den Kammerdiener, den Stabilitätspakt, der ihnen zusätzlich die Luft zum Atmen nimmt.
Dass nun ausgerechnet einer deutschen Regierung das Verdienst zukommt, den Stabilitätspakt faktisch außer Kraft zu setzen, ist eine schöne Ironie der Geschichte, die genüsslich erzählt wird. Aber wie ist es zu dieser Ironie gekommen? Erschöpft sie sich darin, dass die Bundesrepublik sich an ihrer eigenen Kreatur vergreift? Liegt nicht die eigentliche Ironie vielmehr darin, dass die rot-grüne Bundesregierung genau das getan hat, was dem Geist des Stabilitätspaktes entspricht? Nach dem Abgang Lafontaines haben SPD und Grüne sämtliche Dogmen einer vermeintlich „vernünftigen“ Fiskalpolitik übernommen: mehr Steuereinnahmen durch Senkung der Steuersätze, stärkeres Wachstum bei verminderten Sozialleistungen, mehr Investitionen aufgrund geringerer Belastung der Unternehmen und schließlich ein ausgeglichener Haushalt bis 2006. So schön die Lehre, so sperrig die Realität: Kein einziges der rot-grünen Kalküle ist aufgegangen. Statt den Pfad der Tugend zu beschreiten, endet das Land im Jammertal einer langen Stagnation, die sämtliche Rechenmodelle über den Haufen wirft.
Rückblickend müssten sich Schröder und Eichel nun eigentlich fragen, wie sie sich einer Verblendung haben hingeben können, die ihnen mittlerweile fast jeden Handlungsspielraum genommen hat. Ob das passiert, ob im kleinen Kreis Zweifel geäußert und über Konsequenzen nachgedacht wird, wissen wir nicht. Aber wahrscheinlich ist das nicht. Spieler wie Schröder und brave Haushälter wie Eichel betreiben eine Politik nach Nachrichtenstand und Kassenlage. So bleibt ihnen im Moment nur der Mut der Verzweiflung. Den letzten Fehler, den sie noch begehen könnten, mit dem sie ihr wunderbares Reformwerk krönen würden, wollen sie sich ersparen.
Diejenigen, die seit Jahren nur von Strukturreformen sprechen, argumentieren nun unversehens konjunkturpolitisch. Plötzlich zählen nicht mehr die Jahre bis 2010, sondern die nächsten Monate, nicht mehr die großen Verkrustungen, sondern die zarten Keime des Aufschwungs, die es zu pflegen gelte. So richtig es ist, sich den Forderungen der EU-Kommission zu widersetzen und auf die Verantwortung des Staates für den Wirtschaftsverlauf zu verweisen, so unglaubwürdig ist dennoch das Verhalten der Bundesregierung. Mit einer Kehrtwende, mit dem überfälligen Abschied vom eigenen Dogmatismus, hat das ganze Spektakel nichts zu tun. Kopflos greift man nach dem letzten verbliebenen Strohhalm einer höheren Verschuldung. Verschämt wird die Brüsseler Paragrafenreiterei kritisiert. Und – noch dümmer – Eichel führt nationale Interessen ins Feld, um seine Position zu rechtfertigen, und bemüht das Gewicht der deutschen Volkswirtschaft, um sich durchzusetzen: ein kleinkarierter, peinlicher Auftritt, über den sich bestenfalls Greenspan und die Amerikaner freuen können. Das Defizitkriterium von drei Prozent ist nur dann sinnvoll, wenn es nicht auf einzelne Länder, sondern auf die Eurozone insgesamt angewendet wird – selbst dieser bescheidene Vorschlag einer Reform des Stabilitätspakts war nicht zu hören. Ganz zu schweigen von dem Mut, die Zwangsjacke in Frage zu stellen, in der die europäische Währung steckt.